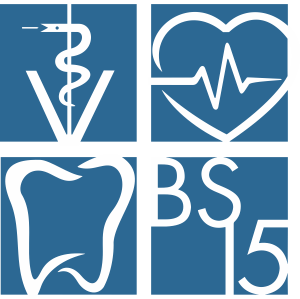Eine Ausbildung mit tierischem Kontakt
Die auszubildenden Tiermedizinischen Fachangestellten (TFA) arbeiten überwiegend in Hamburger Tierarztpraxen und Tierkliniken, zum Teil auch im Hamburger Umland. Ihre Patienten sind überwiegend kleine Haustiere wie Hunde, Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen, Ratten, Vögel, je nach Spezialisierung der jeweiligen Praxis aber auch immer mehr Exoten (z. B. Reptilien, Spinnen), Fische – aber auch- Großtiere wie Pferde, Rinder und Schweine.
Eine TFA darf keine Scheu vor beißenden, tretenden und kratzenden Tieren haben. Sie muss auch mit Tieren umgehen, die sie vielleicht nicht mag (Spinnen! Schlangen!) Und sie darf sich nicht vor Kot, Blut, Eiter und Erbrochenem ekeln. Eine TFA hat es nicht nur mit den eigentlichen Patienten, den Tieren, zu tun, sondern immer auch mit den Besitzern dieser Patienten. Sie muss also über Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, die ihr ermöglichen, sowohl mit leidenden Tieren als auch mit besorgten Besitzern in angemessener Form umzugehen. Unser Unterricht stellt sich auf dieses breite Anforderungsprofil ein.
Der Berufsschulunterricht behandelt immer an einem Fallbeispiel, z.B einem Hund mit einer Otitis (Entzündung des Ohres), die Anatomie und Physiologie (Aufbau und gesunde Vorgänge) – das wären beim Ohr der genaue Aufbau eines Ohres und der Hörvorgang. Danach folgt die Pathologie (krankhafte Veränderungen), hier also die Entzündung des Ohres, die Symptome, Pathogenese, Diagnose, Therapie und Prophylaxe dieser Erkrankung. Die SchülerInnen erstellen zu diesem Krankheitsbild ein passendes, für die Arbeit in der Tierarztpraxis sinnvolles Produkt, z.B. einen Flyer zur Unterstützung der Beratung der Patientenbesitzer. Und dann geht es schon weiter in das nächste Fallbeispiel.
Zum Unterricht der TFAs gehören aber auch andere Fächer, wie z.B Sprache und Kommunikation, Fachenglisch, Wirtschaft und Gesellschaft und Wahlpflichtthemen, wie z.B. berufliche Perspektiven.